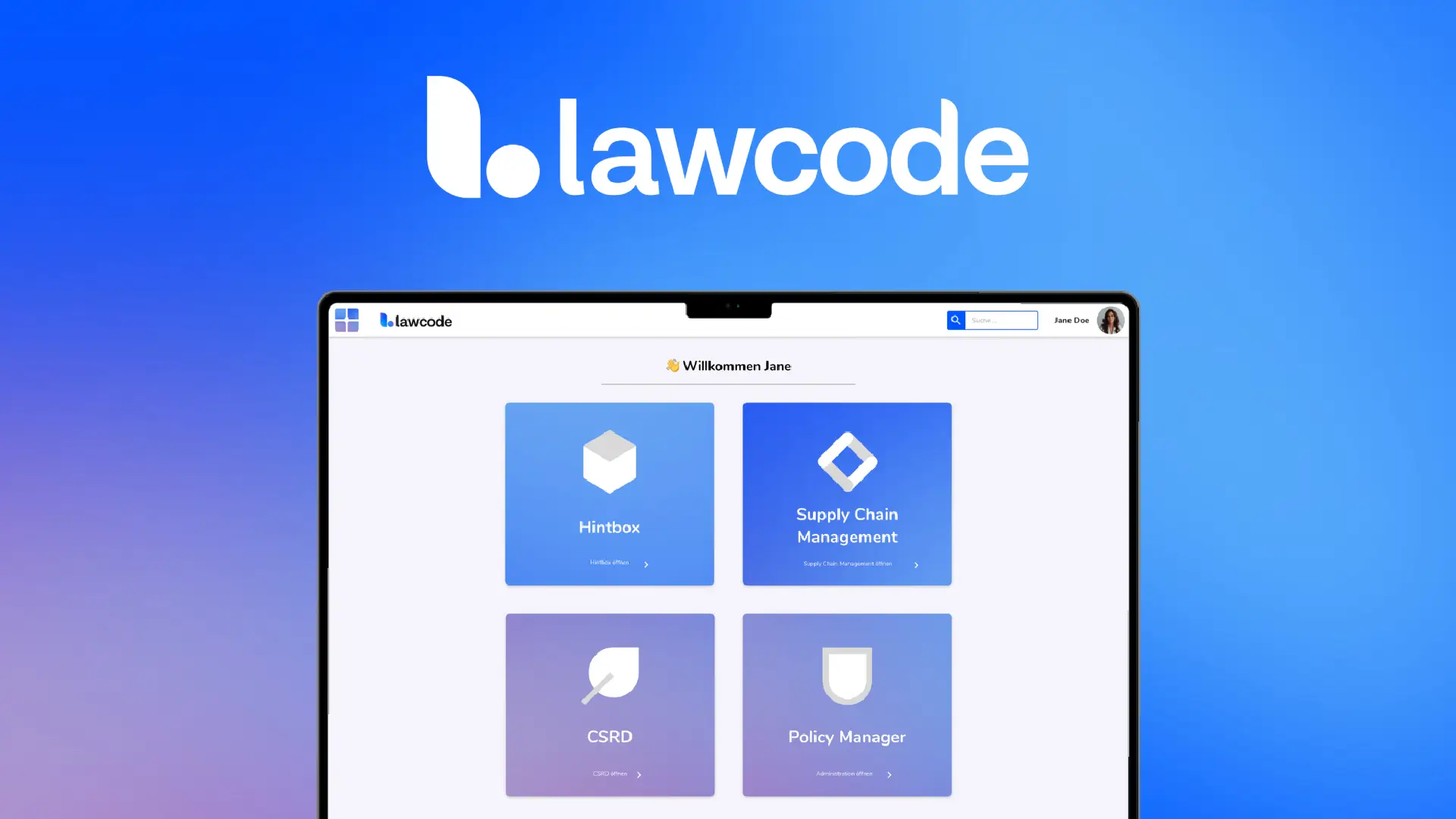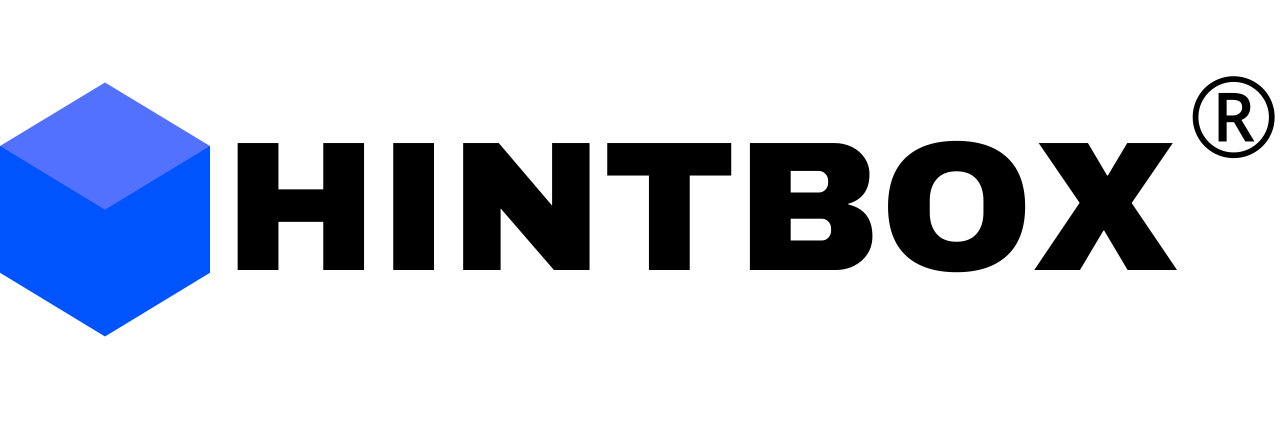Lieferkettengesetz - Aktueller Stand und Details
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in Kraft getreten: Unternehmen ab sofort in der Pflicht, auf ethische Standards des globalen Lieferkettengesetzes zu achten. In einer globalisierten Wirtschaft sind Lieferketten von Unternehmen oft komplex und international vernetzt. Um ethische Standards entlang dieser Lieferketten zu gewährleisten, hat die Bundesregierung das Lieferkettengesetz (LkSG) eingeführt, ein wegweisendes Gesetz, das Unternehmen in die Pflicht nimmt.
Das Lieferkettengesetz im Detail
Sinn und Zweck
Seit dem 1. Januar 2023 gilt das "Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten" (kurz: Lieferkettengesetz oder Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) zunächst für Unternehmen mit mindestens 3.000 Mitarbeitenden. Bisher sind rund 900 deutsche Unternehmen betroffen und müssen das Gesetz ordnungsgemäß umsetzen. Seit 2024 gilt das Gesetz auch für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitenden – davon sind rund 4.800 Unternehmen in Deutschland betroffen. Es verpflichtet Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland dazu, definierte Sorgfaltspflichten umzusetzen und somit Menschenrechte entlang der Lieferkette zu achten.
Diese Gesetzgebung hat somit nicht nur Auswirkungen auf große Konzerne, sondern betrifft künftig auch mittelständische Unternehmen. Im Folgenden erfahren Sie, warum das Gesetz für Ihr Unternehmen von Bedeutung ist. Wir informieren Sie über den Inhalt des Gesetzes und welche umfassenden Anforderungen das Inkrafttreten für Unternehmen mit sich bringt. Zudem erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Folgen ein fehlendes oder unvollständiges Umsetzen des Gesetzes in der Praxis auftreten können.
Das Gesetz ist eine Regelung zur Verbesserung der internationalen Umwelt- und Menschenrechtslage. Das Kernziel des Gesetzes soll die Einhaltung von Menschenrechten und umweltbezogener Pflichten entlang der gesamten Lieferkette sein. Dabei soll die Berücksichtigung der gesamten globalen Lieferkette im Fokus stehen. Das Gesetz legt fest, welche Präventions- und Abhilfemaßnahmen notwendig sind, verpflichtet zu Beschwerdeverfahren und regelmäßiger Berichterstattung.
Um dieses Ziel umzusetzen, verpflichtet das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Unternehmen zur Umsetzung von Sorgfaltspflichten. Diese beziehen sich auf den eigenen Geschäftsbereich, auf das Handeln von Vertragspartnern sowie auf das Handeln von weiteren mittelbaren und unmittelbaren Zulieferern. Die Verantwortung eines Unternehmens endet somit nicht mehr am eigenen Werkstor, sondern besteht entlang der gesamten (globalen) Lieferkette. Die Sorgfaltspflichten definieren sich nach den §§ 3 ff. des Gesetzes. Die neun Sorgfaltspflichten, die sich aus den genannten §§ des Gesetzes ergeben, stellen den Mittelpunkt des Lieferkettengesetzes dar. Sie legen fest, welchen Maßnahmen sich ein deutsches Unternehmen zu unterziehen hat, um individuelle menschrechtliche oder umweltbezogene Risiken zu vermeiden.
Die Sorgfaltspflichten
Folgende 9 Sorgfaltspflichten werden darin festgelegt und sind von Unternehmen sowohl im eigenen Geschäftsbereich als auch bei den Lieferanten zu beachten:
- Risikomanagement einrichten, um potenziell negative Auswirkungen auf das Menschenrecht abzuwenden
- Betriebsinterne Zuständigkeiten festlegen
- Angemessene Risikoanalyse durchführen, um Auswirkungen auf die Menschenrechte zu ermitteln
- Grundsatzerklärung abgeben
- Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich und gegenüber unmittelbaren Zulieferern verankern
- Abhilfemaßnahmen ergreifen
- Beschwerdeverfahren einrichten
- Sorgfaltspflichten in Bezug auf Risiken bei den mittelbaren Zulieferern umsetzen
- Berichterstattung und Dokumentation
Die geschützten Rechtspositionen, bzw. Verstöße gegen Menschen- und Umweltrecht, die sich aus § 2 ergeben, können unter anderem darstellen:
- Ungleichbehandlungen etwa aufgrund von Gesundheitsstatus, Behinderung, Weltanschauung oder sexueller Orientierung, insbesondere durch Zahlung eines ungleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit.
- Alle Formen und Arten von Kinderarbeit und Sklaverei.
- Vorenthalten eines angemessenen Lohns (mindestens der nach geltendem Recht festgelegte Mindestlohn).
- Gewässerverunreinigung, Luftverunreinigung, schädliche Lärmemission.
- Die nicht umweltgerechte Handhabung, Sammlung, Lagerung und Entsorgung von Abfällen.
Die Sorgfaltspflichten verpflichten Unternehmen unter anderem zur Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens sowie eines Risikomanagements. Ebenfalls verpflichtet das Gesetz Unternehmen zu Abhilfemaßnahmen, wenn eine Pflichtverletzung im eigenen Geschäftsbereich oder der Lieferkette bekannt werden sollte.
Bei der Umsetzung der Sorgfaltspflichten sind Unternehmen nicht zu einem Erfolg verpflichtet. Diese Zielbestimmung ergibt sich aus dem hinteren Teil des § 3 und wurde auf Empfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales durch den Gesetzgeber mit in das Gesetz aufgenommen. Die betroffenen Unternehmen müssen folglich nur nachweisen, dass die Einhaltung der Sorgfaltspflichten aus § 4 ff. gewährleistet ist.
Dabei sind jedoch die Pflicht zur Ergreifung von Präventionsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 LkSG) sowie die Pflicht, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen (§ 7 Abs. 1 S. 1 LkSG), nicht als Bemühens, sondern als Erfolgspflichten konzipiert. Erkennbar wird dadurch der präventive Charakter des Gesetzes, indem es heißt, dass Risiken vorzubeugen sind. Die Regierungsbegründung nennt als weiteres Ziel das Gesetz der Rechtssicherheit und fairen Wettbewerbsbedingungen auf dem wirtschaftlichen Markt.
Mit Verabschiedung dieses Gesetzes ist die Verantwortung der Unternehmen für Menschenrechte nicht mehr nur allein die Aufgabe des Staates. Unternehmen müssen erstmals eigenverantwortlich auf die Einhaltung international anerkannter Menschenrechte in ihrem eigenen Geschäftsbereich sowie der gesamten Lieferkette achten.
Entstehung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
Eine Neuheit stellt das deutsche Lieferkettengesetz nicht dar. Die Konzeption und der Inhalt des Gesetzes beruhen auf unterschiedlichen völkerrechtlichen Initiativen und Gesetzen, wie zum Beispiel die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte UNPG, die durch die Vereinten Nationen bereits 2011 beschlossen wurden, sowie auf Basis des nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Maßgeblich für die Gestaltung des Gesetzes waren auch die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. Die Diskussion um die Einführung eines Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes gewann an Fahrt aufgrund zahlreicher Skandale, bei denen Unternehmen in Verbindung mit Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden in ihren Lieferketten standen. Druck seitens der Zivilgesellschaft, NGOs und auch internationalen Entwicklungen in anderen Ländern trugen zur politischen Entscheidung bei, ein solches Gesetz zu erlassen. Zunächst gelten die Leitprinzipien für Unternehmen mit mindestens 3.000 Mitarbeitern, ab 2024 dann auch für Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern.
Zum Erklärvideo des Lieferkettengesetzes durch das BMZ:
Wer ist von dem Gesetz betroffen?
Im Gesetz gilt es nach § 1 zu beachten, welche Unternehmen den Anforderungen in der Praxis nachkommen müssen. Das Lieferkettengesetz richtet sich an Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland und außerdem nach Unternehmensgröße:
- Seit dem 1. Januar 2023 gilt es für alle Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten.
- Seit 2024 gilt es dann bereits für Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten.
Zu beachten ist der erweiterte Kreis an Hinweisgebern, der durch das Gesetz bestimmt wird. Whistleblower können nicht mehr nur Personen aus dem unmittelbaren Geschäftsbereich sein, sondern auch unmittelbare und mittelbare Zulieferer.
Warum sollten sich auch kleinere Unternehmen mit dem Gesetz auseinandersetzen?
Kleine und mittlere Unternehmen mögen sich zunächst fragen, warum das LkSG auch für sie von Relevanz ist. Häufig sind sie integraler Bestandteil von größeren Lieferketten. Selbst wenn sie nicht direkt exportieren, können sie als Zulieferer für größere Unternehmen und Konzerne tätig sein. Die Auseinandersetzung mit dem Gesetz schützt nicht nur vor rechtlichen Konsequenzen, sondern stärkt auch das Image des Unternehmens und ermöglicht eine nachhaltigere und ethisch sichere Geschäftspraxis. Auch kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 3.000 bzw. 1.000 Mitarbeitenden sollten sich deshalb rechtzeitig mit dem Gesetz beschäftigen:
- Große Kunden erwarten die Einhaltung der Vorgaben aus der Lieferkette.
- Vertragliche AGB von Großkunden verpflichten kleinere Zulieferer und Lieferanten zur Einhaltung von Compliance-Vorgaben.
- Ohne die Einhaltung und insbesondere den Nachweis des Gesetzes kommen neue Lieferanten nicht mehr auf das Panel von Kunden. Die Folge: Sie erhalten keine neuen Aufträge mehr.
- Die Einhaltung von Compliance-Vorgaben schafft Vertrauen sowie Transparenz und stärkt Ihr Unternehmen.
Für den Standort Deutschland ist entscheidend, dass die Einführung des Gesetzes einerseits einen wichtigen Impuls für eine europäische Regelung stiftet. Andererseits kann ein solches Gesetz in dynamischer Sicht zu Wettbewerbsvorteilen führen, wenn Unternehmen in der Folge ihre Lieferketten dahin gehend optimieren, dass eine gesteigerte Arbeitnehmerzufriedenheit auch zu Produktivitätssteigerungen führt – oder die Lieferketten insgesamt resilienter werden. „First Mover“ haben aktuell die Möglichkeit, Standards zu setzen.

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung!
Unsere Experten klären mit Ihnen alle Fragen rund um das Lieferkettengesetz und die Hintbox.

Das Lieferkettengesetz in der Unternehmenspraxis
Folgende Kern-Compliance-Pflichten ergeben sich aus dem Gesetz für Unternehmen:
Einrichtung eines Beschwerdemanagementsystems
Unternehmen werden durch das Gesetz verpflichtet, ein Beschwerdeverfahren einzurichten. Dieses ermöglicht es den Personen, Hinweise auf Pflichtverletzungen in der Lieferkette abzugeben. Zweck des Beschwerdeverfahrens ist es, Missstände in der Lieferkette abzustellen oder präventiv zu verhindern. Dadurch kann das Unternehmen vor Bußgeldern und Reputationsschäden bewahrt werden. Insbesondere anonyme Meldekanäle stellen ein effektives Mittel dar, um solche Risiken und Schäden zu vermeiden.
Mit unserer Hintbox und dem von uns entwickelten Formular können Sie schnell, sicher und einfach diese Vorgaben umsetzen. Unsere Hintbox ist ISO 27001 zertifiziert und DSGVO-konform. Über einen Link ist sie zudem für alle Lieferanten weltweit und dauerhaft erreichbar.
Abgabe einer Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte
Die Unternehmensleitung hat diese Erklärung abzugeben (Code of Conduct). Sie beinhaltet unter anderem das Verfahren, mit dem das Unternehmen seinen Pflichten nachkommt. Inhaltlich muss diese gemeinsame Grundsatzerklärung alle Mindestanforderungen gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 LkSG abdecken und die prioritären, menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken aller verpflichteten Konzerngesellschaften aufzeigen. Ferner dokumentiert sie die Erwartungen der Unternehmensseite an seine Beschäftigten und Zulieferer in der Lieferkette. Dies spielt bei der Bewältigung negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte eine große Rolle.
Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen
Risiken im Bereich der Menschen- und Umweltrechte im eigenen Geschäftsbereich müssen analysiert und angemessen priorisiert werden. Diese Risikoanalyse muss einmal im Jahr durchgeführt werden. Das Unternehmen muss in der Lage sein, zu wissen, welche Lieferanten es beauftragt hat und wie die Lieferketten sind. Ferner müssen kritische Lieferanten besonderen Kontrollen und Anforderungen unterzogen werden.
Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 LkSG muss jedes Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten sicherstellen, dass eine Person innerhalb des Unternehmens benannt ist, die für die Überwachung des Risikomanagements zuständig ist, etwa ein Menschenrechtsbeauftragter. Diese Überwachungsperson muss intern benannt und kann nicht extern besetzt werden.
Ergreifen von Präventions- und Abhilfemaßnahmen
Ergibt sich im Rahmen der Risikoanalyse ein Risiko, welches eine Rechtsverletzung nach sich ziehen würde, sind aus Unternehmensseite Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich zu ergreifen. Diese definieren sich als Umsetzungsstrategien und Kontrollmaßnahmen, die sich aus der Grundsatzerklärung (Code of Conduct) ergeben. Sie können zum Beispiel in Form von Durchführung von Schulungen oder Entwicklung von Strategien zur Risikominimierung stattfinden. Dazu zählen auch Präventionsmaßnahmen gegenüber einem unmittelbaren Zulieferer, um den gesamten Umfang der Geschäftstätigkeit abzudecken. Unter anderem die Berücksichtigung der menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Erwartungen bei der Auswahl eines solchen. Weitere Maßnahmen sind in § 6 des Gesetzes ausgeführt.
Öffentliche Dokumentation und Berichterstattung
Die Erfüllung der Pflichten, die sich aus dem Gesetz ergeben, sind fortlaufend zu dokumentieren. Die Unternehmen sind verpflichtet, einen Bericht über die Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten im vergangenen Geschäftsjahr zu erstellen und diesen auf Ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
Werden Rechtsverletzungen offengelegt, müssen die Geschäftsbeziehungen nicht sofort abgebrochen werden. Gemeinsam mit den Betroffenen aus der Lieferkette soll nach Lösungen gesucht werden. Helfen kann hierbei insbesondere ein Maßnahmenplan.
Welche Folgen sind bei fehlender Umsetzung zu erwarten?
Die Folgen bei fehlender Umsetzung des Gesetzes können erheblich sein. Werden die Forderungen aus dem Gesetz nicht oder nicht richtig umgesetzt, kann das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) Bußgelder verhängen, um die Einhaltung des Gesetzes durchzusetzen. Des Weiteren hat das BAFA weitreichende Kontrollbefugnisse: Es kann Geschäftsräume betreten, Auskünfte verlangen und Unterlagen einsehen sowie Unternehmen auffordern, konkrete Handlungen zur Erfüllung ihrer Pflichten vorzunehmen. Dies kann zum Beispiel durch die Verhängung von Zwangsgeldern durchgesetzt werden. Weiterhin besteht das Risiko von Reputationsverlusten, da Verbraucher und Investoren zunehmend ethische Unternehmenspraktiken schätzen und Unternehmen, die diese vernachlässigen, kritisch betrachten. Auch der Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen ist eine mögliche Konsequenz bei Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen.
Bei Ordnungswidrigkeiten können Bußgelder bis zu 800.000 € verhängt werden. Bei Nichteinrichten eines geeigneten Beschwerdeverfahrens kann ein Zwangsgeld von bis zu 50.000 € verordnet werden. Ferner bestehen die zuvor dargestellten wirtschaftlichen Nachteile.
Was tun, wenn es zu einem Verstoß kommt?
Sollte es im eigenen Geschäftsbereich Ihres Unternehmens im In- oder Ausland zu einer Verletzung kommen, so müssen Abhilfemaßnahmen ergriffen werden, die zur sofortigen Beendigung des Verstoßes führt.
Kommt es bei einem unmittelbaren Lieferanten oder Dienstleister zu einer Verletzung, die nicht zeitnah durch das Unternehmen beendet werden kann, muss unverzüglich ein Konzept zur Beendigung oder Minimierung der Verletzung erstellt werden.
Der Abbruch einer Geschäftsbeziehung ist dabei als Ultima Ratio geboten. Hierbei müsste es sich um eine schwerwiegende Verletzung handeln, bei welcher keine Abhilfemaßnahmen eine Beendigung bewirkt haben oder keine milderen Mittel mehr zur Verfügung stehen. Der § 3 Abs. 3 S. 1 stellt klar, dass es keine zivilrechtliche Haftung bei einer Verletzung der Sorgfaltspflichten gibt. Die Anwendbarkeit des Gesetzes hängt von dem satzungsmäßigen Sitz des Unternehmens ab.
Das Gesetzgebungsverfahren im Überblick – aktueller Stand und Details:
- Januar 2023 - Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz tritt in Kraft.
- Juli 2021 - Das Gesetz wurde vom Bundespräsidenten ausgefertigt und in dem Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das Gesetzgebungsverfahren ist formal abgeschlossen und wird am 1. Januar 2023 in Kraft treten.
- Juni 2021 - Der Gesetzentwurf der Bundesregierung über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten wurde in der vom Ausschuss für Arbeit und Soziales geänderten Fassung durch den Bundestag angenommen. In namentlicher Abstimmung votierten 412 Abgeordnete für den Gesetzentwurf, 159 stimmten dagegen, 59 enthielten sich.
- März 2021 - Durch das Europäische Parlament wurde mit einer fraktionsübergreifenden Mehrheit von 504 von 695 Stimmen der “Legislativbericht über menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten von Unternehmen“ verabschiedet. Ein Legislativbericht stellt eine Empfehlung an die EU-Kommission dar, ein Gesetz einzuführen.
- April 2021 - Beratung des Bundestages in erster Lesung zu dem Entwurf des Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten.
Auch wenn das deutsche Gesetz erst seit Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist, soll schon über eine Verschärfung, also ein europaweites EU-Lieferkettengesetz gesprochen werden. Dieses soll vor allem kleinere Unternehmen in die Pflicht nehmen.
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz im Detail: Pro und Contra
Für Kritiker geht das Gesetz bislang nicht weit genug, denn Unternehmen, die weniger als 1.000 Mitarbeitende beschäftigen, sind derzeit vom Gesetz nicht betroffen. Umweltverbände und Menschenrechtsgruppen kritisieren, dass Unternehmen nicht zivilrechtlich für Mängel entlang ihrer Lieferkette haftbar gemacht werden. Des Weiteren bemängeln sie, dass die Sorgfaltspflicht lediglich auf unmittelbare Zulieferer beschränkt ist und nicht die gesamte Lieferkette abdeckt. Unternehmensverbände sehen das hingegen anders: ein strenges Gesetz verursacht hohe Kosten für die Wirtschaft. Nachdem die gesamte Wirtschaft während der Corona-Pandemie schon enorm gelitten hat, schadet das strenge Umsetzen des LkSG dem Wirtschaftsstandort Deutschland nur noch zusätzlich. Vor allem ist es für kleine und mittlere Unternehmen kaum machbar, die gesamte Lieferkette entsprechend zu prüfen. Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) fürchtet durch das Gesetz einen Rückzug von deutschen Investitionen in Afrika, was wiederum die Unabhängigkeit von Asien gefährde. Wiederum andere sind für eine einheitliche Gesetzgebung auf EU-Ebene. So lassen sich Standortnachteile ausschließen. Außerdem fordern sie von der Politik Unterstützung beim Überprüfen der globalen Lieferketten, zum Beispiel mithilfe der Auslandshandelskammer (AHK).
Vorteile des Gesetzes
- Verbraucher achten stärker auf nachhaltige Produktionsbedingungen
Auch bei den Endverbrauchern spielen die Themen rund um Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung (ESG) eine immer wichtigere Rolle. Besonders in den jüngeren Bevölkerungsgruppen wird dieser Gedanke immer stärker. Mittel- bis langfristig benötigen Unternehmen somit neue Geschäftsmodelle und saubere Wertschöpfungsketten, um auch diese Verbrauchergruppen anzusprechen.
- In anderen Ländern gibt es bereits ähnliche Gesetze
In Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz gibt es bereits ähnliche Gesetze. Deutschland ist hier somit kein Vorreiter. Die EU plant sogar ein Gesetz, das noch viel weiter gehen könnte.
- Das Gesetz macht neue Wertschöpfungsmodelle möglich
Für zahlreiche Unternehmen stellt das LkSG ein erster Impuls in Richtung neuer Wertschöpfungsmodelle dar. Durch einen strategischen Blick in die Zukunft kann langfristig eine nachhaltige und sozialverträgliche Umgestaltung von Lieferketten entstehen.
Nachteile des Gesetzes
- Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit
Das Gesetz könnten die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beeinträchtigen, da die Einhaltung zu höheren Compliance-Kosten führen und die Auswahl von Standortmöglichkeiten einschränken kann. Zudem können bürokratische Herausforderungen die Betriebsabläufe verlangsamen und das Vertrauen von Investoren und Kunden beeinträchtigen.
- Unternehmen könnten den Nachweis auf ihre Zulieferer abwälzen
Konzerne und Großunternehmen könnten versuchen, den Aufwand für den Nachweis des Gesetzes auf ihre Zulieferer abzuwälzen. Somit würden die Kosten doch bei kleineren Unternehmen liegen, die bisher aus Wettbewerbsgründen aus dem Lieferkettengesetz ausgeklammert werden.
- Viele Lieferketten sind oft zu lang und komplex
Je nachdem wie komplex die Lieferketten in den Unternehmen sind, lassen sich die Vorschriften einfach oder schwieriger umsetzen. Während unter anderem eine Modemarke Einfluss auf die Arbeitsbedingungen der Näherinnen in Bangladesch nehmen kann, kann dies der Chemiekonzern mit Tausenden Vorprodukten und unzähligen Zulieferern nicht.
- Durch das Gesetz sind Investitionen in bestimmte Länder unattraktiv
Das LkSG könnte dazu führen, dass Unternehmen ihre Produktionsstandorte nicht mehr in Länder mit niedrigeren Arbeitskosten verlagern. Dies könnte der Fall sein, wenn die Überprüfungen der Lieferanten zu aufwendig sind oder die politischen Rahmenbedingungen eine Compliance mit dem Lieferkettengesetz ausschließen. Da diese Produktionsstandorte häufig in ärmeren Ländern liegen würden, könnten Investitionen, die zu wirtschaftlichem Wachstum führen könnte, verhindert werden.
Warum sind Lieferkettengesetze erforderlich?
Viele deutsche Unternehmen waren in der Vergangenheit mehrfach direkt oder indirekt in Katastrophen in anderen Ländern verwickelt, wie z.B. im Jahr 2019 bei einem schweren Dammbruch in Brasilien, bei dem mehr als 250 Menschen ums Leben kamen, oder im Jahr 2012 bei einem Brand in einer Textilfabrik in Pakistan. Dafür müssen künftig auch deutsche Unternehmen Verantwortung übernehmen. Das Einflussvermögen des Unternehmens auf die Lieferkette und die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltauflagen ist ein entscheidender Faktor.
Besonders betroffen sind Unternehmen aus der Textil-, Elektronik- und Automobilbranche. Gleiches gilt für die Pharma- und Lebensmittelindustrie, da Deutschland viele Lebensmittel sowie Chemikalien und Arzneimittel aus dem Ausland importiert.
Der Kampf gegen Armut, Kinderarbeit und Klimawandel
Rana Plaza-Einsturz (Bangladesch, 2013)
Der Einsturz des Rana Plaza-Gebäudes in Bangladesch im Jahr 2013 war eine Tragödie von enormem Ausmaß. Das Gebäude beherbergte mehrere Textilfabriken, in denen Kleidung für weltbekannte Marken hergestellt wurde. Über 1.100 Menschen verloren ihr Leben und Tausende wurden schwer verletzt. Diese Katastrophe hat die Aufmerksamkeit der Welt auf die prekären Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie gelenkt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter waren oft gezwungen, unter gefährlichen Bedingungen zu arbeiten, ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen oder menschenwürdige Arbeitsbedingungen.
Ein Lieferkettengesetz hätte dazu beigetragen, Druck auf Bekleidungshersteller auszuüben, um sicherzustellen, dass die Fabriken, in denen sie produzieren lassen, menschenwürdige Arbeitsbedingungen bieten. Dieses Gesetz hätte klare Richtlinien und Standards festgelegt, an die sich Unternehmen halten müssten, um sicherzustellen, dass ihre Zulieferer fair behandelt werden. Es wäre auch wichtig gewesen, dass dieses Gesetz Sanktionen für Unternehmen vorsieht, die diese Standards nicht einhalten. Dadurch hätten die Hersteller einen Anreiz gehabt, ihre Lieferketten genauer zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie ethisch vertretbar sind. Ein solches Lieferkettengesetz hätte nicht nur den Arbeitern in Bangladesch geholfen, sondern auch anderen Ländern mit ähnlichen Problemen. Es wäre ein wichtiger Schritt hin zu gerechteren Arbeitsbedingungen und einer nachhaltigen Bekleidungsindustrie gewesen.
Kinderarbeit in der Kakaoindustrie (Westafrika)
Die Kinderarbeit in der Kakaoindustrie, insbesondere in Westafrika, ist ein ernstes Problem, das seit vielen Jahren besteht. Berichten zufolge arbeiten Millionen von Kindern unter gefährlichen Bedingungen auf Kakaoplantagen, um den steigenden globalen Bedarf an Kakao zu decken. Um diesem Missstand entgegenzuwirken, wurde ein Gesetz vorgeschlagen, das die Schokoladenhersteller dazu verpflichtet hätte, sicherzustellen, dass ihr Kakao nicht unter Verletzung von Kinderrechten gewonnen wird. Dieses Gesetz würde es den Unternehmen auferlegen, strenge Kontrollmechanismen einzuführen und ihre Lieferketten zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Kinderarbeit involviert ist.
Durch die Implementierung dieses Gesetzes hätten die Schokoladenhersteller die Verantwortung übernehmen müssen, sicherzustellen, dass sie nur Kakao aus ethisch vertretbaren Quellen beziehen. Sie wären verpflichtet gewesen, regelmäßige Überprüfungen durchzuführen und transparente Berichte über ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Kinderarbeit vorzulegen. Weiterhin hätte das Gesetz auch Sanktionen für Unternehmen vorgesehen, die gegen diese Bestimmungen verstoßen. Dies könnte von Geldstrafen bis hin zum Entzug von Zertifizierungen oder dem Ausschluss vom Markt reichen. Dadurch sollte ein Anreiz geschaffen werden, dass Schokoladenhersteller aktiv Maßnahmen ergreifen, um Kinderarbeit in ihrer Lieferkette zu bekämpfen.
Umweltzerstörung durch Ölpalmenplantagen (Südostasien)
Die Auswirkungen von Ölpalmenplantagen auf die Umwelt in Südostasien sind verheerend. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Palmöl, das in vielen Produkten wie Lebensmitteln, Kosmetika und Bioenergie verwendet wird, werden große Flächen Regenwald gerodet, um Platz für Plantagen zu schaffen. Die Abholzung führt nicht nur zum Verlust wertvoller natürlicher Lebensräume und zur Dezimierung zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, sondern auch zu erheblichen CO₂-Emissionen. Die Entwaldung trägt maßgeblich zum Klimawandel bei und verschärft die bereits bestehenden Probleme wie Dürren und Überschwemmungen.
Weiterhin hat die Anlage von Ölpalmenplantagen auch negative Auswirkungen auf die Bodenqualität. Die Böden werden durch den intensiven Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln geschädigt, was langfristig zu einer Verschlechterung der landwirtschaftlichen Produktivität führt. Ein Gesetz für Lieferketten könnte dazu beitragen, diese Umweltschäden einzudämmen. Unternehmen, die Palmöl verwenden oder damit handeln, müssten sich an strenge Umweltauflagen halten und sicherstellen, dass ihr Palmöl aus nachhaltigen Quellen stammt. Dadurch würden sie zur Rechenschaft gezogen und gezwungen sein, alternative Methoden des Anbaus zu suchen, die weniger schädlich für die Umwelt sind.
Zusätzlich sollten solche Gesetze auch Maßnahmen vorsehen, um den Schutz der indigenen Bevölkerung und ihrer Rechte zu gewährleisten. Oftmals werden diese Gemeinschaften von der Ausbreitung der Plantagen vertrieben oder ihre Lebensgrundlagen werden zerstört. Es ist wichtig, dass sowohl Regierungen als auch Verbraucher*innen bewusster mit dem Thema Palmöl umgehen und nachhaltige Alternativen unterstützen. Durch den Kauf von Produkten, die auf den Einsatz von Palmöl verzichten oder zertifiziertes nachhaltiges Palmöl verwenden, können wir alle einen Beitrag zum Schutz der Umwelt und des Regenwaldes leisten.
Konfliktmineralien im Kongo
Die Ausbeutung von Konfliktmineralien im Kongo ist ein ernstes Problem, das sowohl die Menschenrechte als auch den Frieden in der Region gefährdet. Die Abbaumethoden sind oft äußerst gefährlich und führen zu zahlreichen Arbeitsunfällen und Gesundheitsproblemen bei den Minenarbeitern. Zudem werden die Gewinne aus dem Verkauf dieser Mineralien häufig genutzt, um bewaffnete Konflikte zu finanzieren. Um diesem Missstand entgegenzuwirken, wurde ein Gesetz vorgeschlagen, das Unternehmen dazu verpflichtet hätte, die Herkunft ihrer Mineralien zu überwachen. Dadurch sollten sie sicherstellen, dass diese nicht aus Konfliktgebieten stammen. Diese Maßnahme wäre ein wichtiger Schritt gewesen, um die Nachfrage nach Konfliktmineralien zu verringern und somit den Anreiz für bewaffnete Gruppen zur weiteren Ausbeutung der Ressourcen zu mindern.
Doch trotz internationaler Bemühungen und Druck seitens der Zivilgesellschaft wurden solche Gesetze bisher nur vereinzelt umgesetzt. Viele Unternehmen scheuen sich davor, ihre Lieferketten transparent offenzulegen oder haben Schwierigkeiten, die tatsächliche Herkunft ihrer Mineralien nachzuvollziehen. Dies erschwert es Verbrauchern, ethisch verantwortungsvolle Entscheidungen beim Kauf von elektronischen Geräten zu treffen, da Coltan beispielsweise in vielen Elektronikprodukten wie Handys verbaut wird. Es ist daher dringend erforderlich, dass sowohl Regierungen als auch Unternehmen ihre Verantwortung wahrnehmen und Maßnahmen ergreifen, um den Handel mit Konfliktmineralien einzudämmen. Dies könnte beispielsweise durch die Einführung strengerer Vorschriften für Unternehmen oder die Förderung von alternativen Einkommensquellen in den betroffenen Gebieten geschehen.
Elektronikproduktion in China
Die Elektronikindustrie in China ist bekannt für wiederholte Arbeitsrechtsverletzungen und schlechte Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Arbeiterinnen und Arbeiter werden oft mit unfairen Löhnen, übermäßigen Arbeitszeiten und mangelnden Sicherheitsvorkehrungen konfrontiert. Diese Missstände haben zu öffentlicher Empörung geführt und die Forderung nach einem Lieferkettengesetz verstärkt. Ein solches Gesetz würde Unternehmen dazu verpflichten, sicherzustellen, dass ihre Zulieferer die Rechte der Arbeiter respektieren. Es würde sie zur Verantwortung ziehen und ihnen klare Richtlinien geben, wie sie sicherstellen können, dass ihre Produkte unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt werden.
Durch ein Lieferkettengesetz würden Unternehmen gezwungen sein, ihre Zuliefererketten genauer zu überprüfen und sicherzustellen, dass diese sozialen Standards eingehalten werden. Dies könnte durch regelmäßige Inspektionen vor Ort oder die Zusammenarbeit mit unabhängigen Organisationen erfolgen. Ansonsten würde ein solches Gesetz auch den Druck auf Unternehmen erhöhen, transparenter zu sein und Informationen über ihre Lieferketten offenzulegen. Dadurch könnten Verbraucherinnen und Verbraucher bewusste Kaufentscheidungen treffen und sich für ethischere Produkte entscheiden.
Fazit zum LkSG: Ein Meilenstein für Unternehmensverantwortung
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung einer globalen Wirtschaft dar, die auf ethischen Prinzipien basiert. Die Einhaltung dieses Gesetzes ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern bietet auch die Möglichkeit für Unternehmen, nachhaltige und ethische Geschäftspraktiken zu etablieren. Die sorgfältige Umsetzung trägt nicht nur zur Risikominimierung, sondern auch zur Stärkung des Unternehmensimages und langfristigen Wettbewerbsvorteilen bei. Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, sollten das LkSG als Chance begreifen, ihre Lieferketten verantwortungsbewusst zu gestalten und einen positiven Beitrag zur globalen Wirtschaft zu leisten.
Unsere Tipps für die Praxis
Nicht zu lange warten.
- Kümmern Sie sich rechtzeitig um die Einrichtung professioneller Beschwerdekanäle.
- Implementieren Sie noch heute Ihre digitalen Beschwerdekanäle mit unserer ISO 27001 zertifizierten Hintbox.
Setzen Sie die Sorgfaltspflichten aus dem LkSG zügig um.
- Validieren und bewerten Sie Ihre mittel- und unmittelbaren Lieferanten.
- Setzen Sie die Dokumentations- und Prüfungsvorgaben zeitnah um.